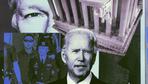Aktuelle Meldungen
Klimawandel: So viel kostet die Klimakrise
Der Klimawandel sorgt für Verluste, die bisherige Wirtschaftskrisen in den Schatten stellen. Neue Daten zeigen, wie günstig Klimaschutz im Vergleich zu den Schäden ist. Quelle:…
Julian Assange: Entscheidung über Berufungsantrag von Assange soll im Mai fallen
Die USA schließen eine Todesstrafe für Assange aus und versichern sein Recht auf den ersten Verfassungszusatz. Damit rückt die Entscheidung im Auslieferungsprozess näher. Quelle: ZEIT…
Doktoren im Digitalfieber: Wir sind dran!
Nach Jahren der Skepsis entdecken deutsche Ärzte die Magie der Digitalisierung. Die Flut schreckt sie kaum: Alle 73 Tage verdoppeln sich die Gesundheitsdaten. Eine entscheidende…
E-Autos: Zehn Minuten laden, 700 Kilometer Reichweite
Viele Deutsche lehnen E-Autos ab – aus Sorge, sie ständig laden zu müssen. Dabei schreitet die Entwicklung neuer Akkus rasant voran. Batterieforscher Maximilian Fichtner über…
Russland: Neue russische Cyberwaffe entdeckt
Russlands Geheimdienst hat offenbar ein neues Werkzeug entwickelt, um Firmen auszuspionieren. Es gibt nur wenige Spuren, denn die Schadsoftware löscht sich teils selbst. Quelle: ZEIT…
Neurowissenschaft: Warum ein Psychiater anders über Krisen spricht als Greta Thunberg
Der Neurowissenschaftler Volker Busch erforscht Stress und Belastung. Im Podcast sagt er, wie die Gesellschaft besser durch die Krisen käme. Quelle: ZEIT Wissen
Karl Lauterbach spricht von einer halben Million Long-Covid-Kranken
Die Pandemie ist vorbei, doch Langzeitfolgen machen vielen noch zu schaffen. Der Gesundheitsminister geht von einer halben Million Betroffenen aus, Tendenz steigend. Dennoch spricht er…
El Niño: Wetterphänomen endet wohl noch in diesem Frühjahr
Weltweit sorgt derzeit ein ausgeprägter El Niño für besonders hohe Temperaturen in der Luft und den Ozeanen. Doch in wenigen Wochen ist damit Schluss, sagen…
Klimakrise: Experten kritisieren Regierung wegen fragwürdiger Klimaziele 2030
Die Emissionen sinken hierzulande – aber nicht wegen ehrgeizigen Klimaschutzes. Wirtschaftsminister Habeck glaubt trotzdem, dass Deutschland seine Klimaziele schafft. Fachleute halten das für eine gewagte…
USA: Gentrifizierung fördert Artenvielfalt in Städten
Teure Mieten, Angst vor Verdrängung: Für Einwohner wird Gentrifizierung schnell zum Problem, Tiere wiederum profitieren einer Studie zufolge von dem Phänomen. Wenngleich Forscher Handlungsbedarf sehen….
ISS-Trümmer: Nasa bestätigt – Weltraumschrott trifft Haus in Florida
Trümmer fielen im März vom Himmel und durchbohrten das Haus einer Familie in Florida. Nun bestätigt die Nasa: Bei den Teilen handelte es sich um…
Elektrochemie ebnet den Weg: Nachhaltige Synthesemethode enthüllt N-Hydroxy-Modifikationen für Pharmazie-Forschung
Neue hochselektive und skalierbare elektroorganische Synthese von neuartigen Benzo[e]-1,2,4-thiadiazin-1,1-dioxiden, die ein wichtiges strukturelles Motiv von APIs (aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen) darstellen, die mit einer einzigartigen N-Hydroxyeinheit…
Ein Enzym macht Pilze „magisch“
Neue Studie gibt Aufschluss über Struktur und Evolution eines Enzyms in psychoaktiven Pilzen Ein internationales Forschungsteam hat die Biosynthese von Psilocybin untersucht, dem Hauptinhaltsstoff halluzinogener…
Studie zeigt ungenutzte Kapazitäten für den Netzanschluss von Erneuerbaren-Kraftwerken
Deutschland sitzt auf einem gewaltigen Schatz ungenutzter Kapazitäten für den Netzanschluss von Erneuerbaren-Kraftwerken. Das zeigt die Studie zur gemeinsamen Nutzung von Netzverknüpfungspunkten, die der Bundesverband…
Hirsche passen Physiologie der Muskeln an Jahreszeit an
Am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) der Vetmeduni ging man in einer aktuellen Studie der Frage nach, wie Rothirsche sich auf zellulärer Ebene auf…
„Ein Ring … sie alle zu binden“: Wie Aktinfilamente durch Formine zusammengesetzt werden
Dortmunder Max-Plank-Forschende entschlüsseln auf molekularer Ebene, wie ringförmige Forminproteine das Wachstum von Aktinfilamenten in Zellen fördern Quelle: IDW Informationsdienst Wissenschaft
Riesling-Weine: Erstmals menschlicher Geruchsrezeptor für charakteristische Petrolnote identifiziert
Der Klimawandel macht auch vor Weinreben nicht halt. Zu viel Sonne führt dazu, dass das Bouquet von deutschen Riesling-Weinen immer stärker von einer Petrolnote geprägt…
Verdrehter Pollenschlauch macht unfruchtbar
Polyploide Pflanzen mit mehrfachen Chromosomensätzen sind salztolerant oder dürreresistent und erzielen oft höhere Erträge. Frisch gebildete polyploide Pflanzen sind jedoch oft steril oder nur vermindert…
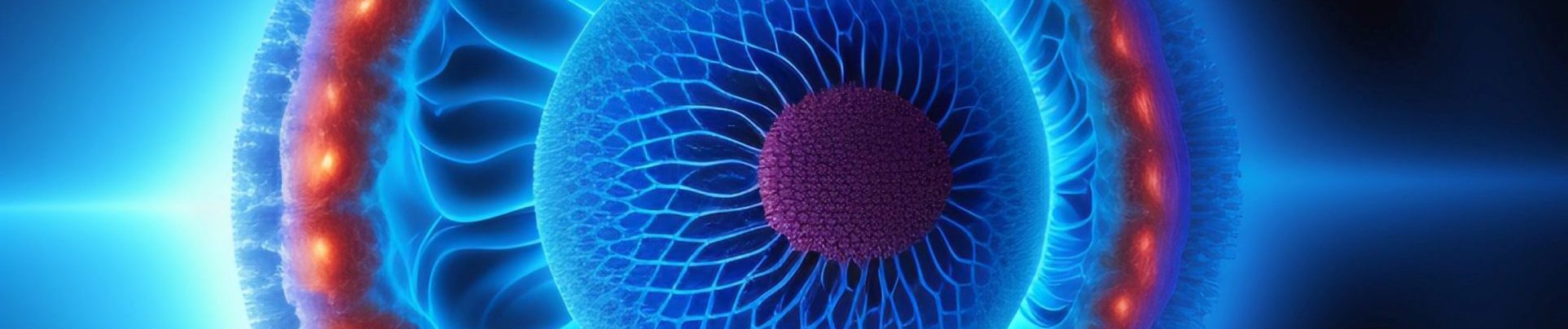




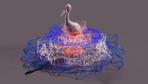



































































.gif)
.gif)
.gif)











.jpg)





.gif)